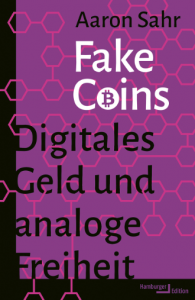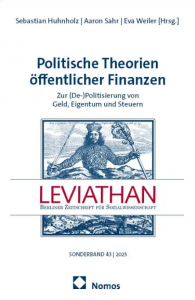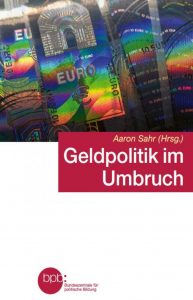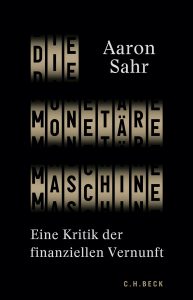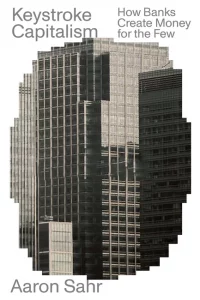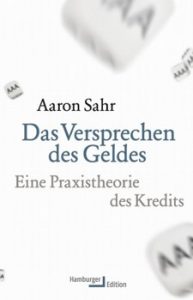Bücher
Publikationen
Monographien
Die monetäre Maschine. Eine Kritik der finanziellen Vernunft. C.H. Beck 2022.
- Karl-Polanyi-Preis 2022 der Sektion Wirtschaftssoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
- Rezensionen, Podcasts und Videos zum Buch finden sich hier
Keystroke-Kapitalismus. Ungleichheit auf Knopfdruck. Hamburger Edition 2017.
- 2022 in englischer Übersetzung bei Verso erschienen
- 2019 als Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung unter dem Titel „Ungleichheit auf Knopfdruck. Die Spielregeln des Keystroke-Kapitalismus“ als Taschenbuch neu aufgelegt.
- Auf der Shortlist des Hans-Matthöfer-Preis für Wirtschaftspublizistik 2018.
- „Geisteswissenschaften International“ Auszeichnung durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. im Herbst 2019
Das Versprechen des Geldes. Eine Praxistheorie des Kredits. Hamburger Edition 2017.
- Auf der Shortlist für den „Opus Primum“ Preis für die beste wissenschaftliche Nachwuchspublikation 2017.
- Gegenstand eines Diskussionsforums der Zeitschrift für theoretische Soziologie (Jg. 7, H. 1).
- Rezensionen u.a. in der KZfSS, dem European Journal of Sociology, dem Suiss Journal of Sociology und der Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Herausgeberschaften
Politische Theorien öffentlicher Finanzen. Zur (De-)Politisierung von Geld, Eigentum und Steuern. Baden-Baden: Nomos, 2025 (Leviathan; Sonderband 43, mit Sebastian Huhnholz und Eva Weiler)
Geldpolitik im Umbruch. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2024
Perspektiven der Geldsoziologie. Themenheft des Mittelweg 36 28(3-4), Juni/Juli 2019 (Gastherausgeberschaft zusammen mit Philipp Degens).
Aufsätze und Sammelbeiträge
Politische Theorie(n) öffentlicher Finanzen. Zur Förderung eines interdisziplinären Sondervermögens. In: Sebastian Huhnholz, Aaron Sahr, Eva Weiler (Hg.): Politische Theorien öffentlicher Finanzen. Zur (De-)Politisierung von Geld, Eigentum und Steuern. Baden-Baden: Nomos, 2025; S. 7-49 (mit Sebastian Huhnholz und Eva Weiler)
Über das Gelddrucken. In: Smail Rapic (Hg.): Geld. Eine symbolische Realität? Berlin: de Gruyter, 2025; S. 141-170
Woher das Geld kommt und wer davon profitiert. In: Deutschland & Europa. Zeitschrift für Gemeinschaftskunde, Geschichte und Wirtschaft. 41(2024),87; S. 56-59
Die Politik des Geldes ist in Bewegung. In: Aaron Sahr (Hg.): Geldpolitik im Umbruch. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2024; S. 7-25
Waffenfähige Ansprüche. Zur Militarisierung des Geldes im Ukrainekrieg. In: Aaron Sahr (Hg.): Geldpolitik im Umbruch. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2024; S. 195-216
Inflation überwinden. Über das Zerrbild der Geldentwertung. In: Mittelweg 36. 32(2023),6; S. 3-24 (mit Luca Kokol und Carolin Müller)
Claims to sovereignty. MMT as a challenge to money’s technical imaginary. In: Benjamin Braun, Kai Koddenbrock (Hg.): Capital claims: power and global finance. Abingdon (u.a.): Routledge, 2023; S. 88-103
(No) interest in money. About the political fiction of monetary neutrality. In: Sven Kalden (Hg.): LBBMADXXL. Hamburg: Textem Verlag, 2023; S. 9-10
Monetäre Kriegsführung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 72(2022),18/19; S. 40-45
Contested privatisation: on the state of monetary sovereignty in the euro zone. In: Christopher Smith (Hg.): Sovereignty. A global perspective. Oxford: Oxford University Press, 2022; S. 210-234 (mit Carolin Müller)
Pokerspiele in der Ghettoökonomie. Zur symbolischen Repräsentation von Ungleichheit durch monetäre Topoi im deutschen Gangstarap. In: Marc Dietrich, Martin Seeliger (Hg.): Deutscher Gangsta-Rap III. Soziale Konflikte und kulturelle Repräsentationen. Bielefeld: transcript, 2022; S. 271-299 (mit Martin Seeliger)
Axel T. Paul: Theorie des Geldes. In: Klaus Kraemer, Florian Brugger (Hg.): Schlüsselwerke der Wirtschaftssoziologie . 2., aktual. u. erw. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, 2021; S. 613-618.
Reputation und Randständigkeit. Andrew Abbott und die Suche nach der prozessualen Soziologie. In: Andrew Abbott: Zeit zählt. Grundzüge einer prozessualen Soziologie. Hamburg: Hamburger Edition, 2020; S. 7-61 (zus. mit Thomas Hoebel und Wolfgang Knöbl).
Wie Geldschöpfung für Ungleichheit sorgt. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Wir Kapitalisten. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2020; S. 100-102
Zwischen Pflichten und Fiktionen. Zur politischen Dimension des Euro aus der Perspektive einer beziehungstheoretischen Geldsoziologie. In: Zeitschrift für Soziologie. 48(2019),3; S. 209-225.
Die Rückkehr des Geldes. In: Mittelweg 36 28(3-4), 2019, S. 3-49 (zus. mit Philipp Degens).
Kredit, Kapital, Kaufkraft. Dimensionen der Geldsoziologie. In: Zeitschrift für theoretische Soziologie 1/2018, S. 119-128.
Von Vermögen zu Versprechen. Für eine beziehungstheoretische Soziologie des Geldes. In: Zeitschrift für theoretische Soziologie 1/2018, S. 40-61.
Sind Banken Distributoren oder Produzenten von Geld? Eine Diskussion alternativer Theoriemodelle des Kreditsystems. In: Jürgen Beyer, Konstanze Senge (Hg.): Finanzmarktsoziologie. Entscheidungen, Ungewissheit und Geldordnung. Wiesbaden: Springer VS, 2018; S. 201-215.
Gesellschaft der Gäste. In: Soziale Welt, 86(2017), 1, S. S. 113 – 117 (zus. mit Philipp Staab).
Reichtum aus Feenstaub. Das Free-Lunch Privileg im Keystroke-Kapitalismus. In: Bude, Heinz/Staab, Philipp (Hg.), Ungleichheit im Kapitalismus, Campus, 2016, S. 25-44.
Wären wir die besseren Banken? Zur Debatte um die Repolitisierung des Kreditgeldes. In: Widerspruch. 34(2015),66; S. 103-113.
Von Richard Nixon zur 1.000.000.000.000-$-Münze. Kreditgeld als politische Verknappungsaufgabe. In: Mittelweg 36. 22(2013),3; S. 4-31.
Häuser, Händler und Helden. Über Kreditgeld, die Eurokrise und „Monopoly“-Politik. In: Mittelweg 36. 21(2012),5; S. 53-72.
Bahnhof der Leidenschaften. Zur politischen Semantik eines unwahrscheinlichen Ereignisses. In: Mittelweg 36. 20(2011),3; S. 23-48 (zus. mit Philipp Staab).
Varia
Geld – Was ist das eigentlich? Online-Dossier „Wirtschaftspolitik“ der Bundeszentrale für politische Bildung, 2025.
Der Euro soll schießen lernen. Wie die Präsidentin der Europäischen Zentralbank die Aufrüstungsdebatte um ein geldpolitisches Argument erweiterte. In: Soziopolis, 5. Juni 2025 (mit Florian Schmidt)
Geldpolitik ist Gesellschaftsgestaltung. Deshalb gehört sie zukünftig auf die Vorderbühne der Demokratie. In: OXI – Wirtschaft anders denken. (2022),10; S. 4-5
Geldschöpfungspolitik. Missverständnisse und Missverhältnisse monetärer Souveränität in Europa (III). In: Soziopolis, 4. Februar 2020 (zus. mit Friedo Karth, Carolin Müller)
Staatliche Zahlungs(un)fähigkeit. Missverständnisse und Missverhältnisse monetärer Souveränität in Europa (II). In: Soziopolis, 28. Januar 2020 (zus. mit Friedo Karth, Carolin Müller)
Geld in privaten Händen. Missverständnisse und Missverhältnisse monetärer Souveränität in Europa (I). In: Soziopolis, 21. Januar 2020 (zus. mit Friedo Karth, Carolin Müller)
Die Rückkehr des Geldes in die Politik. Beitrag im Deutschlandfunk, Reihe „Essay und Diskurs“ vom 17.11.2019.
Geld auf Knopfdruck. Das Bankenprivileg, Geld aus dem Nichts zu schöpfen, beschleunigt die Umverteilung von unten nach oben. In: Stefan Mahlke (Hg.): Atlas der Globalisierung. Welt in Bewegung. Berlin 2019; S. 72-73.
Geld aus dem Nichts. In: Der Freitag, 29.03.2018, S. 13.
Der wunderbare Geldschalter. In: Le Monde Diplomatique, September 2017, S. 2.
Rezensionen
Because People Die! On Money, Sovereignty, and Mythical Debt – Michel Aglietta, Money. 5,000 Years of Debt and Power (London, Verso, 2018). European Journal of Sociology, 60(3), 2019, S. 390-400.
Brötchen-Tinder. [Rezension zu:] Stefan Heidenreich: Geld. Für eine non-monetäre Ökonomie. Berlin: Merve Verlag, 2017. In: Soziopolis, 23. Oktober 2018
Einzahlen, Auszahlen, Bezahlen. Axel T. Paul über seine Theorie des Geldes und die Wirtschaftssoziologie im Allgemeinen. [Rezension zu:] Axel T. Paul: Theorie des Geldes zur Einführung. Hamburg: Junius, 2017. In: Soziopolis, 29. März 2018
[Rezension zu:] Ariel Wilkis: The moral power of money. Morality and economy in the life of the poor. Stanford: Stanford University Press, 2018. In: Economic sociology. The European electronic newsletter. 20(2018),1; S. 41-43
Der Geist war willig, aber das Fleisch blieb schwach. [Rezension zu:] Franka Schäfer, Anna Daniel, Frank Hillebrandt (Hg.): Methoden einer Soziologie der Praxis. Bielefeld: Transcript, 2015. In: Soziopolis, 5. Dezember 2015
Podcasts, Interviews & Videos (Auswahl)
Mehr
The History of Money in Video Games • Körber-Stiftung (koerber-stiftung.de)
Aaron Sahr: »Die Inflation klingt heute wie ein Naturgesetz. Das ist sie nicht« – DER SPIEGEL
Die monetäre Maschine – mit Prof. Aaron Sahr – Wirtschaftsfragen – Podcast (podigee.io)
Aaron Sahr, Die monetäre Maschine und ich – Einmischen! Politik Podcast (podigee.io)
Vorträge
Zuletzt
- Digitale Verfügungsfreiheit. Monetäre Souveränität im Bitcoin-Kosmos. Vortrag auf der 6. Sitzung des Arbeitskreises Geld:Technik:Demokratie des ZEVEDI in Frankfurt am Main, 05. Dezember 2025.
- Bitcoin – Eine Währung der Freiheit? Öffentlicher Abendvortrag im Rahmen der Reihe „Verfassung der Freiheit“ am Hamburger Institut für Sozialforschung, 24. April 2025.
- Die Schöpfung des Geldes. Zur Geschichte (und Zukunft) einer politischen Institution. Öffentlicher Vortrag im Rahmen der Ausstellung „Cash! Eine Geschichte des Geldes“ am Kultur- und Stadthistorischen Museum Duisburg, 19. Januar 2025.
- Lohnarbeit als Schuldverhältnis? Potenziale und Grenzen des bilanztheoretischen Paradigmas für die Sozioökonomie. Vortrag im IAW Colloquium an der Universität Bremen, 13. Juni 2024.
- Digitales Zentralbankgeld: Beharrungskräfte der Depolitisierung? Vortrag auf der 3. Sitzung des Arbeitskreises Geld:Technik:Demokratie des ZEVEDI in Berlin, 12. April 2024.
- Geld in militärischen Konflikten. Über monetäre Kriegsführung und die Zukunft globaler Zahlungssysteme. Öffentlicher Abendvortrag im Rahmen der Reihe „Im Nebel des Krieges“ am Hamburger Institut für Sozialforschung, 02. April 2024.
Zuvor
- Was ist eigentlich Wirtschaft? Geldtheorie als Kritik der finanziellen Vernunft. Vortrag im Rahmen des Jour Fixe an der FEST Heidelberg, 14. Februar 2023.
- Die Zukunft des Geldes. Reihe „Konturen der nächsten Gesellschaft“ der Katholischen Akademie Freiburg, 17. November 2022.
- Wie neutral ist Geld? Vortrag auf dem Aha-Festival am Bernischen Historischen Museum, 11. November 2022.
- Pawnshop Capitalism. On the Privatization and „Propertization“ of Monetary Sovereignty. Annual Conference of the Collaborative Research Center Structural Change of Property, University of Jena, 05. Oktober 2022.
- Geld gegen Freiheit. Anatomie einer komplexen Ambivalenz. Ringvorlesung „Freiheit – Access denied?“ an der Leuphana Universität Lüneburg, 09. Dezember 2021.
- Darf Geld nicht demokratisch sein? Über die Ideologie eines unpolitischen Tauschmittels. Vortrag an der HHU Düsseldorf, 28. September 2021.
- Was ist falsch am Gelddrucken? Zur Entwicklung, Verdrängung und Kritik eines kapitalistischen Privilegs. Ringvorlesung „Economics and Beyond“ an der Leuphana Universität Lüneburg, 24. Juni 2021
- Monetäre Souveränität zwischen privater und öffentlicher Hand. Der digitale Euro als politisches Feigenblatt? Vortrag am Weizenbaum-Institut, Berlin, 26.04.2021
- Befristete Knappheit, oder: können wir uns unser Geld noch leisten? Vortrag in der Ad-Hoc Gruppe „Ökonomie der Unknappheit – Neue Spannungen kapitalistischer Vergesellschaftung?“ auf dem Soziologiekongress 2020, 21. September 2020.
- Knappheit im Überfluss. Paradoxien modernen Geldes. Vortrag auf der Tagung Gebrochene Versprechen: Moderne/Modernität als historische Erfahrung, Weimar, 06. Dezember 2019.
- Zahlungen. Zur politischen Anatomie einer modernen Praxis. Öffentlicher Abendvortrag am Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main, 25. November 2019.
- „Wir leben monetär in revolutionären Zeiten“. Rede anlässlich der Verleihung des Franz-Xaver-Kaufmann-Preises, Universität Bielefeld, 13. November 2019.
- Coupling Money Grids in Europe – the Political Dimensions of Money from a Relationist Perspective. Vortrag auf dem Panel „‚Governing through Markets‘ – Governing Finance and Money in a Post-Crisis World“ auf dem 31st Annual Meeting der Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) an der New School, New York, 27. Juni 2019.
- Gefallen und Vergeltung. Eine Beziehungssoziologie des (europäischen) Geldes. Vortrag im Soziologischen Kolloquium der Universität Duisburg-Essen, 22. Mai 2019.
- Money, Capital, and Surplus – On Two Versions of a Theoretical Trinity. Vortrag auf dem Workshop des DFG-Forschungsnetzwerks Politics of Money in Hamburg, 22. November 2018.
- Wie krisenanfällig ist der digitale Kapitalismus? Vortrag auf der Tagung #DigitalCapitalism der Friedrich Ebert Stiftung in Berlin, 07. November 2018.
- Über Stabilität und Humanismus Sozialontologische Abwägungen zwischen Praxis und Prozess. Vortrag auf dem Soziologiekongress in Göttingen, 27. September 2018.
- Schulden und Profite. Die Geldordnung des Keystroke-Kapitalismus, Vortrag im Forschungskolloquium „Ordnungen der Ungleichheit“ an der Universität Konstanz, 03. Juli 2018.
- Geld auf Knopfdruck. Braucht der Kapitalismus eine Schuldnerberatung?, Keynote bei der Fachwoche Sozialberatung für Schuldner(innen) des Deutscher Caritasverband e.V., 26. Juni 2018.
- Keystroke-Kapitalismus. Ungleichheit auf Knopfdruck, Vortrag im Kolloquium „Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik“ an der LMU München, 13. Juni 2018.
- Keystroke Capitalism, Vortrag im Interdisziplinären Kolloquium der Europa-Universität Flensburg in der Reihe „Konflikt – Krise – Kritik“, 19.06.2018.
- Ungleichheit auf Knopfdruck, Vortrag bei „Impuls. e.V.“ – Mitglied des Netzwerks Plurale Ökonomik an der Universität Erfurt, 06. Juni 2018.
- From Pen Strokes to Keystrokes: the Production of Money in Early and Contemporary Capitalism, Vortrag auf der Konferenz „The Dynamics of Capitalism: Inquiries to Marx on the occasion of his 200th birthday” vom MPIfG (Köln) und Hamburger Institut für Sozialforschung, 04. Mai 2018.
- Praxis des Geldes. Eine Einführung in Finanzmärkte, Auftaktvorlesung der Reihe „10 Years After the Crash“ auf Einladung des Vereins Möve. e.V. – Mitglied des Netzwerks Plurale Ökonomik an der Leuphana Universität Lüneburg, 24. April 2018.
- Ungleichheit im Keystroke-Kapitalismus. Zur Politischen Ökonomie des Geldes, öffentlicher Abendvortrag bei der Gesellschaft für Soziologie an der Universität Graz, 20. März.2018.
- Kapital auf Knopfdruck: Stehen wir vor einer dritten finanziellen Revolution?, öffentlicher Vortrag am DAI Heidelberg, 07. März 2018.
- Irreguläre Aneignung – Ungleichheit im Keystroke-Kapitalismus, Keynote auf der Jahrestagung des Vereins Monetative e.V., 11. November 2017.
- Waren zwei eine zu viel? Finanzrevolutionen, Krisen und der Abschied von Marx, öffentlicher Vortrag bei der „Nacht des Wissens“ am Hamburger Institut für Sozialforschung, 04. November 2017.
- Gibt es eine Praxistheorie sozialer Prozesse? Kartographie eine Problemlage, Vortrag bei dem Workshop „Theoretische und methodische Problemstellungen soziologischer Prozessforschung“ des Arbeitskreises „Historische Soziologie und soziologische Prozessforschung“ (Bielefeld), 18. Mai 2017.
- Ungerechtigkeit auf Knopfdruck. Über Vermögen im Keystroke-Kapitalismus, Vortrag im Rahmen der Forumsveranstaltung zum Thema Gerechtigkeit an der Leuphana Universität Lüneburg, 3. Februar 2017.
- Paraeconomic Wealth: Keystroke Capitalism as an Appropriative Structure, Vortrag auf dem Workshop “The Resilience of Finance Capitalism” am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 5. Dezember 2016.
- Minsky’s Challenge: Theorizing an Economy without Scarcity, Vortrag auf der 27. Jahrestagung der EAEPE “A New Role for the Financial System” in Genua, 19. September 2015.
- Warum es nicht klug war, die Banken abzuschaffen: Überlegungen zur Restauration der europäischen Geldordnung, Vortrag auf der Konferenz „Soziologie der Finanzmärkte – Institutionelle Einbettung, organisationale Strukturen und Konturen einer Geldordnung“, Universität Hamburg, 21. März 2013.
- Bahnhof der Leidenschaften Zur politischen Semantik eines unwahrscheinlichen Ereignisses, öffentlicher Vortrag in der Reihe „Stuttgart 21 – Reflexiv“ am HAU Theater in Berlin, 8. März 2011.
(Auswahl)